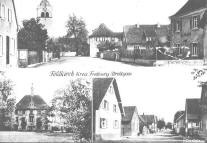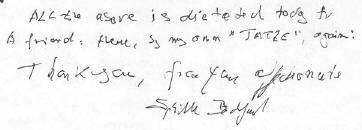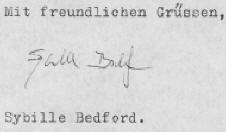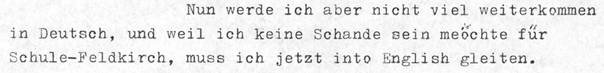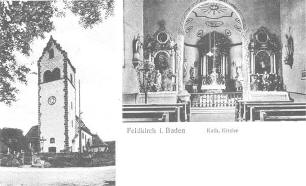Feldkirch
in literarischen Zeugnissen
|
Ignaz Heinrich von Wessenberg
dichtete 1826:
„Gruß an Feldkirch
Manch alter Freund am alten Ort zeigt
jetzt sein Antlitz mir,
Die bläulichen Vogesen dort, der dunkle
Schwarzwald hier;
So mancher Baum, der Frucht mir bot, der
Traubenhügel Glanz,
Das alte Früh- und Abendrot, im Teich
des Mondes Glanz.
Bist immer jung und wunderschön, du
freundliche Natur!
Indess, die deinen Liebreiz sehn,
vergehn fast ohne Spur.
die Mutter ach! der Vater ach! Sie sehn
dich nimmer blühn,
mit Wehmut blick ich ihnen nach, dort,
wo die Sterne glühn.“
|

Seltenbach vor der Begradigung. Bild
1931. |
|

Postkarte vor 1908 |
Der Freiburger Stadtpfarrer und
Schriftsteller Heinrich Hansjakob fuhr auf einer Fahrt in den Süden
im Frühsommer 1905 durch Feldkirch:
„In dem stattlichen Dorfe Feldkirch müssen
kultivierte Bauern wohnen. Sie fahren auf dem Zweirad ins Heu und an Sonn=
und Feiertagen sicher auch in die weite Welt."
|
 |
"Die Straße führt an dem alten Schlosse
der Freiherrn von Wessenberg vorüber, welche hier Grundherren waren
und jetzt ausgestorben sind. Der bekannteste dieses alten
Schweizergeschlechts ist der Konstanzer 'Bistumsverweser' Ignaz
Heinrich von Wessenberg.
Er war in Feldkirch nicht geboren,
verbrachte aber seine erste Knabenzeit hier und kam, so lange seine
Eltern lebten, die seit seinem zweiten Lebens-jahre ständig da
wohnten, immer wieder ins väterliche Schloß zurück.“.
„Heute ist das Stammschloß des alten
Geschlechtes von Wessenberg ver-ödet, und die Güter sind im Besitze
der Bauern.“
(aus: Heinrich Hansjakob, Alpenrosen mit
Dornen. Tagebuchblätter. Waldkirch 1988, S. 8 und S. 13).
|
Sybille Bedford, 1911 in Berlin
geborene Tochter des Ehepaars von Schoenebeck, verbrachte einen Teil ihre
Kindheit im Schloss Feldkirch und berichtet davon recht ausführlich in
ihrem 1989 auf englisch erschienen Buch „Jigsaw. An unsentimental
Education“ (Die Laubsäge. Eine unsentimentale Erziehung; Jigsawpuzzle =
Puzzlespiel); deutscher Titel "Zeitschatten".
Geboren am 16. März 1911 in Berlin -
Charlottenburg als Sybilla Aleid Elsa von Schoenebeck.
Tochter von Maximilian Josef von Schoenebeck
(22.7.1853 - 4.12.1925), in 2. Ehe verheiratet seit 23. Januar 1910 mit
Elisabeth Bernhard, geb. am 24.10.1888.
1935 Heirat mit Walter Bedford.
Nach Aufenthalten in Berlin, Frankfurt,
Feldkirch, Frankreich, Spanien und Italien lebt Sybille Bedford als
Autorin in London.
Mitarbeit an europäischen und amerikanischen
Zeitschriften: Vogue, The New York Times, Esquire, Life Magazine, Saturday
Evening Post, The Spectator, Observer u. a.
Mitglied (Fellow)
der Royal Society of Literature. Companion of
Literatur (eines von 10 Mitgliedern wie u. a. Doris Lessing, Harold Pinter,
Muriel Spark oder V. S. Naipaul).
Vizepräsindentin des Internationalen PEN.
Befreundet mit Elisabeth Jane Howard und 35
Jahre lang mit Aldous Huxley.
|

Ehepaar Elisabeth Bernhard und
Maximilian Josef von Schönebeck |

Sybille Bedford, Karikatur
von Davin Levine |

Sybille Bedford zwischen Aldous Huxley
und Eva Herrmann um 1930.
|
|

Schloss Feldkirch, die beiden Esel,
Ziegen und "Lina". |
„Es muss das Jahr 1919 sein. Wir sind
wieder in Baden, zu Hause, im Dorf Feldkirch. Ein alter Name – eine
Kirche auf einem Feld. Die Kirche, schlicht romanisch, ist noch da,
unser Haus ist ein kleines Schloss, drinnen Zimmerfluchten, angefüllt
mit meines Vaters Sammlung von Möbeln und Kunstgegenständen, die
Decken sind hoch, und alles erscheint mir unermesslich groß. Vor dem
Krieg, zur Zeit meiner Mutter, war hier viel Leben: meine Schwester
war bei uns und ihre französische Gouvernante, die Zofe meiner Mutter
und eine Köchin, die Mädchen aus dem Dorf, der Haus-diener, ebenfalls
Franzose, der Kutscher und der Stallbursche, der Gärtner und ein
liederlicher Italiener, der das Stromaggregat bediente.
etzt sind wir nur noch zu dritt. Mein
Vater, Lina, eine dünne, drahtige ältere Frau aus dem Dorf, und ich.
Lina ist gütig und geduldig, und sie macht alles. (...) Sie putzt,
kocht, lüftet (wir lüften sehr viel, wegen der Sammlung), sie wäscht,
hackt das Feuerholz und trägt es nach oben, zündet die Öfen und den
Herd an, kümmert sich um das Geflügel und um das, was von unserem
Küchengarten übrig geblieben ist (den Rest haben sich die Nesseln
geholt), und sie mistet mit meiner Hilfe den Eselstall aus.“
(S. 21 f.) |
|
 |
Sybille hatte die Aufgabe, zum
Abendessen den Wein zu holen: „In der einen Hand halte ich eine Kerze,
in der anderen werde ich eine Flasche halten (bringe sie vorsichtig
nach oben), mir bleibt keine freie Hand, um mich zu bekreuzigen,
wenn der Geist erscheint. Er ist ein Bischof, Wessenberg war sein
Name, und soll hier in der Halle eine abscheuliche Tat begangen haben.
Lina hat mir eine Beschwörung beigebracht, die ich anwenden soll,
falls ich, was der Himmel verhüten möge, ihn sehen sollte, ein
Liedchen, Alles was atmet, lobe den Herrn, aber das Bekreuzigen
ist ausschlaggebend. Wenn ich wohlbehalten wieder oben in dem
erleuchteten Zimmer bin, mit dem richtigen Wein, und die Kerze ist
nicht erloschen, schenkt mein Vater mir oft ein Stück Lebkuchen oder
ein Paar Geldstücke, Gefahrenzulage.“ (S.43)
„Und wovon lebten wir? Weitgehend
durch Tauschhandel, und hier entwickelte mein Vater, der auf dem Land
groß geworden war, eine gewisse Genialität. Wir hatten nämlich kein
Land, das uns ernähren konnte, nur Park und Rasen, Innenhöfe und
Zufahrten, wo die Nesseln hüfthoch standen. Er hatte eine Wiese von
einem Mann mit einem Pferd umpflügen lassen und das Gras unter
Kartoffeln und Mohn gegeben. Der Mohn diente zur Herstellung von
Speiseöl, Mohnsamenöl – Lina und ich mussten die Kapseln knacken und
schälen, während mein armer Vater, dem das alles zuwider war, traurig
von Oliven träumte. Wir kochten und heizten mit Holz aus dem Park, und
es blieb noch genug, um es gegen Futter für die Esel und Hühner sowie
Mehl für unser Brot einzutauschen. Wir hatten fast dreihundert
Apfelbäume, bekanntermaßen gute Sorten, zum Essen und für Apfelwein,
und auch diese wurden getauscht gegen Milch, Sahne – wir stampften
unsere Butter selbst - , Honig und Arbeitsstunden. Alle paar Monate
kam ein Metzgergehilfe von dem Marktflecken, um ein Schaf oder ein
Schwein zu schlachten. Wir hatten Geflügel und Eier, wir bauten Gemüse
und an einer Südwand sogar Weintrauben an. Aus diesen machte mein
Vater im Oktober ein kleines Quantum guten Weißwein.“ (S. 37 f.) |
|

Schulbild 1921 mit Lehrer Schülin und
Pfarrer Schwendi.
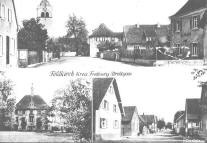
Postkarte mit Schule und altem Rathaus
1960


Heinrich Rinderle, Bürgermeister 1896 -
1926, vor seinem Haus.

Rudolf Kling sen. pflügt mit gemischtem
Gespann

Hausschlachtung 1930
|
„Das Schulhaus war ein neueres Gebäude,
von irgendeiner fernen Autorität in Auftrag gegeben – ein
Klassenzimmer im Erdgeschoß und oben einige Waschräume, eine Wohnung
für den Lehrer und seine Familie -, und es roch nach Zement, Linoleum
und Pisse. Hierher wurde ich eines Tages mitten im Schuljahr gebracht.
Die Kinder, etwa dreißig an der Zahl, saßen in Bänken, ein jedes mit
einer Tafel vor sich, die Mädchen auf einer Seite, die Jungen auf der
anderen, durch einen Gang getrennt. Sie waren dem Alter nach gesetzt
worden, die Sechsjährigen in der ersten Reihe, die Elfjährigen ganz
hinten. Der Lehrer, ein ziemlich junger Mann im Straßenanzug, kam
herein, und alle standen auf und sagten im Chor, Grüß Gott, Herr
Lehrer. Er ging nach vorne und begann mit einer höchst
faszinierenden Tätigkeit – er ließ jede Reihe zur gleichen Zeit etwas
anderes lernen. (...) Wir Neun-jährigen, ein Mädchen und ich sowie
drei Knaben auf der anderen Seite des Ganges, mussten abwechselnd laut
lesen. (...) Der Unterricht wurde in Hochdeutsch mit starkem südlichen
Einschlag erteilt, und auch die Kinder sagten ihre Lektionen auf
Hochdeutsch auf, das ziemlich gestelzt herauskam, doch wenn sie
redeten, auch mit dem Lehrer, verfielen sie wieder in ihre Mundart.“
(S. 40 f.) |
|
„Die Mädchen waren duckmäuserisch, und
die meisten waren ohne große Hoffnung beim Lernen, die Knaben waren
faul und laut. Die Hauptbestrafung waren Tatzen, Rutenstreiche
auf die Hand. (...) Manchmal warf der Lehrer einen Knaben kurzerhand
über das Pult und versohlte ihm das Hinterteil. Der Knabe schrie
gewöhnlich, stoisches Ertragen zahlte sich nicht aus ...“ (41)
„Der Unterricht dauerte nicht lange, da
von den Kindern genau wie von mir erwartet wurde, daß sie zu Hause
mithalfen. Nachmittags von eins bis vier kamen wir unteren Klassen,
morgens von sieben bis elf die Zwölf- bis Fünfzehnjährigen. Ebenso
richteten sich die Ferien nach den Erfordernisen der Feldarbeit und
der Jahreszeiten – Heuferien, Ernteferien, Kartof-fel- und
Holzhackferien. Ich kann mich auch nicht an viele Hausaufgaben
erinnern. Wenn die Dreschmaschine zum Einsatz kam oder jemand eine
Scheune reparierte, bekamen die Kinder den Tag frei – wir saßen auf
Leitern, bildeten eine Kette und reichten Ziegel hinauf.“ (41)
„... Da waren zunächst die Kinder.
Obwohl sie mir anfangs mit Neugierde und Zurückhaltung begegneten
(ihre Eltern und der Lehrer gaben mir den absurden Namen Baroneß Billi
– Billi wurde ich in meiner Familie genannt, eine Verballhornung der
letzten Silben meines Vornamens), versuchte ich mit dem Eifer eines
Hündchens Freundschaften zu schließen. Wo sind sie jetzt, meine
flüchtigen Gefährtinnen aus Feldkirch (denn meine Schultage waren
gezählt)? Wo waren sie 1933, und was haben sie gemacht? 1939? 1945?
Josephina, meine Altersgenossin, ein stilles, blasses Mädchen mit
streng zurückgekämmten schwarzen Haaren? Clara, auch ein langsames
Kind, Katharina, die sich nie wusch – ich wusch mich auch nicht, wenn
es sich vermeiden ließ – und die ich zu Streichen verleiten konnte,
die fünf Martin-Mädchen, jedes ein Jahr älter und fünf Zentimeter
größer als das nächste und ansonsten genau gleich? Die Mädchen waren
im großen und ganzen eine zahme Gruppe, ihre Vorstellung von Spielen
bestand darin, Arm in Arm Sonntag nachmittags auf der Dorfstraße zu
flanieren und da-bei lauthals traurige Lieder zu singen. Ich wandte
mich bald den Jungen zu und gründete mit drei älteren, Alphons, Robert
und Anton, eine Bande, denn wir hatten dieselben Interessen: meinen
Metallbaukasten, Eisenbahn-spielen, auf einen Ackergaul steigen, wenn
niemand hinsah.
Mich interessierte ihr Zuhause, und ich
ging gern nach der Schule mit zu meinen neuen Freunden. Von ihren
Eltern wurde ich gastlich aufgenommen. Sie saßen bei der
Vier-Uhr-Mahlzeit, Z’fiere ne‘ in badischer Mundart, die eine
Sprache für sich ist. Die Kost war in allen Häusern die gleiche:
kalter roher Speck, Brot und Apfelwein.“ (S. 42) |
|
„Es war ein kleines Dorf, eine lange
kurvige Straße, ungepflastert, ein paar Feldwege, gut
zweihundertfünfzig Einwohner in weniger als fünfzig Häu-sern. Es gab
wohl vier Nachnamen, Rinderle, Faller, Martin und Hauser. Alle
betrieben Landwirtschaft, ausgenommen der Priester und der Lehrer, und
fast alle bestellten ihr eigenes Land. Manche hatten nur einen oder
zwei Morgen, andere hatten dreißig oder vierzig. Einige waren
angeblich durch Hypotheken hoch verschuldet, manche waren recht
wohlhabend. Ein paar hatten noch eine Nebenbeschäftigung wie die
Schmiede, das Postamt (mit dem einzigen Telefon, das um sieben Uhr
abends stillgelegt wurde), den Dorfladen und das Wirtshaus. Alle
führten ein ähnliches Leben. Die Häuser unterschieden sich in der
Größe, waren alle aus Stein, und die mei-sten hatten zwei Stockwerke.
Einige waren blitzsauber mit polierten Koch-herden und Fußböden, einem
reinlichen, ruhigen Wohnzimmer, einem Elternschlafzimmer mit
Warenhauseinrichtung, Doppelbett, Kleider-schrank, gerahmten
Hochzeitsfotos auf der Kommode, oft auch eine Foto-grafie von einem
(vor so kurzer Zeit erst) im Krieg gefallenen Sohn. Einige Häuser
waren weniger makellos, einige waren schlampig. Hinter dem Haus war
der Hof mit dem Misthaufen, der Pumpe und dem Trog, nur das Schulhaus,
das Pfarrhaus und das Schloß hatten eine Wasserleitung. Dahinter lagen
die Ställe und Scheunen, und auch diese sprachen für sich. |
|
Die des Bürgermeisters waren ein
erfreulicher Anblick, die Ställe luftig, die Streu hoch und sauber,
die Kammer mit dem Pferdegeschirr blitzeblank, die Milchkannen
geschrubbt, der Apfelspeicher süßduftend. Hier gab es einen ummauerten
Weingarten. Der Bürgermeister hatte, wie einige andere Großbauern,
vier Pferde, die meisten hatten nur eins, und oft sah man ein Pferd
und einen Ochsen vor ein Fuhrwerk gespannt. Ein Großteil der Arbeit
verrichteten Ochsen, aber ein Mann, der zugleich der Schuster war,
mußte seine einzige Kuh vor den Pflug spannen.“ (S. 43)
„Die Männer konnten ins Wirtshaus gehen,
um zu trinken und Karten zu spielen, ins Gasthaus zum Kreuz, ein
schlampiges, muffiges Lokal, wo es nach nassen Stiefeln und Schnaps
roch – ich bin ein-, zweimal hineingegangen, um Limonade zu holen.“
(45)
„... Ich hatte es vermutet: Einige
meiner Mitschülerinnen hatten Läuse, nicht alle, nicht viele (...)
Meine Haare wurden stündlich mit dem Staub-kamm bearbeitet, Tag für
Tag mit Petroleum gewaschen, bis wir die Läuse mitsamt den Nissen los
waren. Dem unterwarf ich mich, aber jetzt sprach mein Vater ein
Machtwort. Dies war das Ende meiner Schultage.“ (S. 57)
(Alle Zitate aus: Sybille Bedford,
Zeitschatten. Ein biographischer Roman. Reinbek bei Hamburg 1992).
|
|
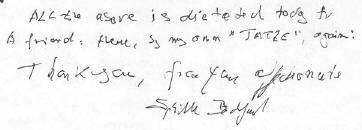 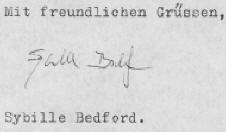
"All the above is
dictated to A friend: Here, my own "Tatze", again:
I thank you,
from your affectionate..." Brief vom 12.
04. 2004.
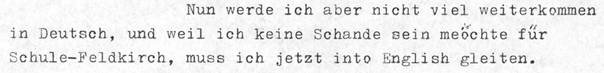
Aus einem Brief von Frau Bedford an E.
Weeger, 22. März 1993
|
|

Freiherr von Griesinger und Frau Ilonka.
Schlossbewohner 1926 - 1958.
|
|
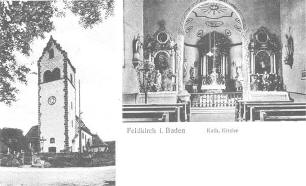
Pfarrkirche St.Martin, Mauer des alten
Friedhofs. Postkarte um 1922. |
Werke:
- The
Sudden View. A Mexican Yourney. 1953. Später: A Visit to Don
Octavio. A Traveller's Tale from Mexico.
Deutsch: Zu Besuch bei
Don Octavio. Eine
mexikanische Reise. 1960.
- A Legacy. Deutsch: Das
Legat 1969; Das Vermächtnis 1988 und 1993.
Neuausgabe: Ein Vermächtnis 2003.
- The
Best We Can Do. An Account of the Trial of John Bodkin Adams.
-
1958
und 1959: The Trial of Dr. Adams. Deutsch:
Der Fall John Bodkin Adams 1958.
- The Faces of Justice 1961.
Deutsch: Fünf Gesichter der Gerechtigkeit.
-
Justiz in England,
Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich 1964.
- A Favourite of Gods.
Deutsch: Ein Liebling der Götter 1965 und 1978.
- A Compass Error 1968; in
den USA 1969.
- Aldous
Huxley. A Biography I. 1973, II. 1974.
- Jigsaw. An
Unsentimental Education 1989. Deutsch: Zeitschatten.
Ein bio-
graphischer Roman 1992.
-
As it Was. Pleasures, Landscapes and Justice.
1990.
Idee, Konzeption und Gestaltung,
Ausführung, Fotoarbeiten, Scans, Texte
von Edmund Weeger, Archivar.
Texte
für die Objekte, Bilder, Bücher im Wandregal:
Montranz "Wettersegen", Feldkirch,
Kreuzpartikel, Authentik im Fuß.
Die Einwohnerschaft von Feldkirch um 1901
anlässlich der Investiturfeier von
Pfarrer Käpplein
für den Fotografen aufgereiht.
Bildband:
Feldkirch. Bilder aus vergangenen Tagen.
Zusammenstellung und Text: Ruth Burghart.
Horb am Neckar 1992.
Pierre Maria von Wessenberg.
Skizzen einer Lebensreise
1858 - 1942
Von Paris bis Purgstall.
Hrsg. Peter Heinrich von Wessenberg.
A-Weitra [1993].
CD mit
Wessenberg-Suite.
Diese Artikel sind im Rathaus Hartheim
käuflich zu erwerben.
Ganz oben:
Werke von Sybille Bedford.
(Sammlungen Gemeindearchiv Hartheim
und Edmund Weeger).
|